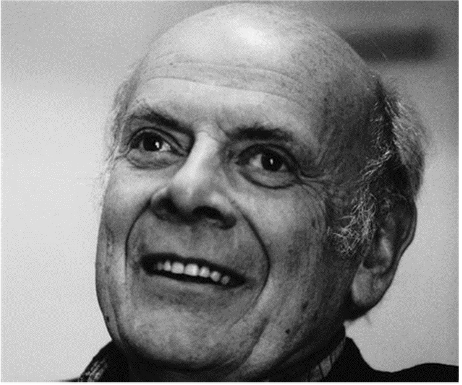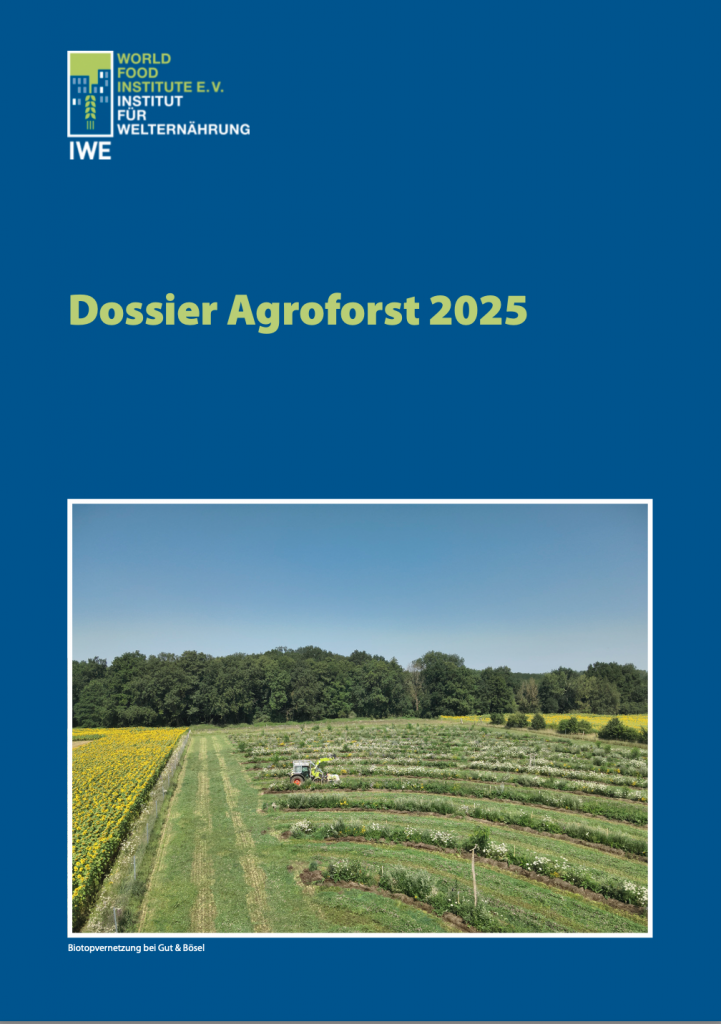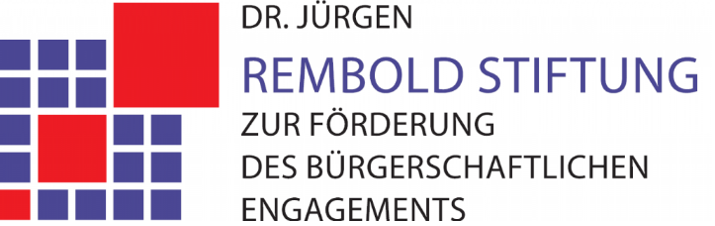Kommentar von Peter Wogenstein, Vorstandssprecher des Instituts für Welternährung (IWE) und Gründer des „Netzwerks der Ernährungsräte Niedersachsens“
Hannover, der 12. Dezember 2025
Niedersachsen stellt jetzt Ernährungsarmut in den Fokus. Ein Schritt, der überfällig ist, ist doch jede/r Sechste in unserer Gesellschaft armutsgefährdet. Viel zu viele leiden an Ernährungsarmut. Besonders hart trifft es dann Kinder und Jugendliche in armen und armutsgefährdeten Familien. Eine eingeschränkte körperliche und geistige Entwicklung sind die Folge, soziale und psychische Belastung kommen hinzu, und Kinder in dieser Situation erfinden dann „Geschichten“ – wie gestern berichtet wurde –, um mit der erlebten Scham klar zu kommen. Dazu kommen durch mangelnde und schlechte Ernährung gesundheitliche Folgen wie Adipositas und Diabetes 2. So folgt der Armut die Scham, oft verbunden mit Krankheit und Wohnungslosigkeit.
Gründe genug, zu handeln. Und so stellte Miriam Staudte, Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gleich 13 Handlungsfelder vor, die der Ernährungsarmut und ihren Folgen begegnen sollen. Sie reichen von „Die ersten tausend Tage in den Blick nehmen“ über „beitragsfreie und qualitativ hochwertige Kita- und Schulverpflegung“ bis zu „Kosten einer gesundheitsfördernden Ernährung“ in der „staatlichen Grundsicherungsleistung adäquat berücksichtigen“. Dies legt insbesondere den Fokus auf die Altersgruppe der Neugeborenen, der Kinder und Jugendlichen, für deren Entwicklung und weiteren Lebensweg gesunde Ernährung besonders wichtig ist. Die Gruppe der Erwachsenen und alten, oft alleinstehenden Menschen sind in den Handlungsfeldern mit eingeschlossen bis zur Förderung der Tafeln in unserem Land. Ernährungsarmut zieht sich durch alle Altersgruppen, und dafür muss, wie Miriam Staudte ausführt, auch Geld in die Hand genommen werden.
Aber genau das ist das Problem. Hier fehlt es an Geld. Denn der eigentliche Skandal bei der Lektüre der Handlungsfelder gegen Ernährungsarmut ist, wie sehr die Armen unter uns in dieser doch reichen Gesellschaft im Stich gelassen werden. Viele Initiativen sind unterwegs vom Schulfrühstück über Obst in Schulen, Kochen im Viertel bis zur Tafel. Das Grundproblem wird jedoch nicht angegangen durch uns als Gesellschaft und unsere Vertreterinnen und Vertreter des Landes- und des Bundesparlaments.
Wissenschaftliche Studien belegen die Notwendigkeit von möglichst nahrhafter Gesundheit. Skandinavien macht uns schon lange vor, dass kostenfreie gesunde Verpflegung in Schulen machbar ist und belegt auch wissenschaftlich die positiven Auswirkungen für die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder.
Bei uns tut sich grundsätzlich und strukturell… wenig. Kein Engagement in der Politik für kostenfreie Kita- und Schulverpflegung, kein Interesse, das komplexe Bündel der Sozialleistungen, das sich über Kommune, Land und Bund zieht, aufzudröseln und zu verschlanken und dafür zu sorgen, dass das Geld dahin kommt, wo es für gesunde Ernährung am meisten gebraucht wir: für die Neugeborenen in den ersten tausend Tagen, für die Kinder und Jugendlichen, für Kranke und alte Menschen. Das wäre auch ein „gesunder“ Schritt Richtung weniger Bürokratie.
Warum hört Politik nicht auf den vom Bundestag eingesetzten Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ und seine Empfehlungen: gut begründet, gerechnet und mit großem Nachdruck dem Bundestag nahegebracht?
Warum ist das so? In einer Studie (November 2024) finden sich die vier wichtigsten Gründe, warum Politik für gesunde Ernährung scheitert:
1. Versuche, Einfluss auf das Ernährungsverhalten in der Gesellschaft zu nehmen, werden in der öffentlichen Diskussion vehement als „Bevormundung“ abgetan.
2. Die massive Lobbyarbeit der Lebensmittelindustrie und die Furcht vor negativen Auswirkungen in der Wirtschaft hindern, Einsichten und Wissen in Gesetze umzusetzen.
3. Das Thema Ernährung hat es noch nie in die Liste der Topthemen der Politik geschafft.
4. Die Verantwortung für gesunde Ernährung ist über zahlreiche Ministerien verstreut. Da Ernährung und das Ernährungssystem eine komplexe und weitläufige Angelegenheit sind, wird jeder Gestaltungsversuch zu einem politischen Such- und Verwirrspiel. Die Briten nennen es: „Whack-the-Mole“ – Fang den Maulwurf.
So bleibt das „Problem“ „Gesunde Ernährung für alle“ und „Ernährungsarmut“ da hängen, wo es alle hinschieben: beim Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das bemüht sich sehr. Doch es braucht mehr. So auch eine laute zivilgesellschaftliche Stimme, die die Politik vor Ort, im Land und im Bund auf den Missstand immer wieder hinweist.