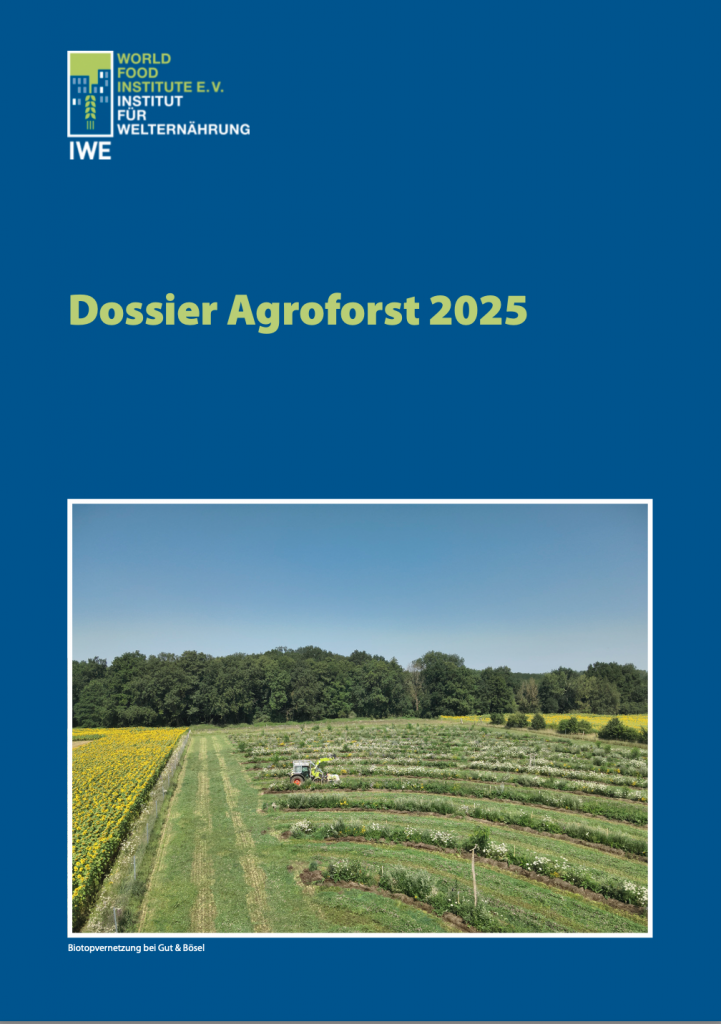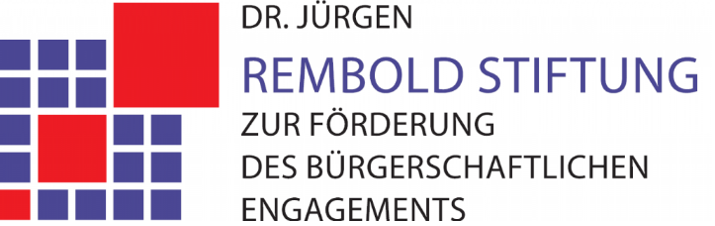Von Walter Jehne / Übersetzt und zusammengefasst von Wilhelm Wallefeld
Zur Lage
Kann die Landwirtschaft dazu beitragen, die kommenden Klimaextreme abzufedern? Kann sie sie stoppen? Sie könnte wesentlich mehr, aber dazu müsste ihre Rolle im Klimawandel neu gedacht werden. Der australische Wissenschaftler Walter Jehne, international bekannter Boden-Mikrobiologe und Innovationsstratege, sammelte seine Erfahrungen durch die Analyse von Böden, Weideland, Wald und Agrarflächen und brachte seine Erkenntnisse als Australia’s National Soil Advocate und international auf (UN-)Ebene in die Öffentlichkeit, wurde jedoch in Deutschland bisher kaum gewürdigt. Er beschreibt die Chancen für das Ausbremsen, die im Boden und der Vegetation liegen. Sie sind größer als gedacht. Wenn man sie nicht mehr auf ihre Funktion als CO2- Speicher reduziert, denn darin ist ihre Wirkung nicht nur bescheiden, sondern im Anbetracht der schnellfortschreitenden Bedrohung durch den Klimawandel fast wirkungslos.
Längst ist klar, dass die Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5C nicht zu halten sein wird. Die dazu notwendige Verringerung von CO2 bleibt illusorisch. Selbst wenn wir den Zuwachs auf ‘net zero’ bis 2050 herunterfahren könnten, würde der CO2-Gehalt in der Atmosphäre nur konstant bleiben, aber nicht fallen.
„Extinction“ – unausweichlich?
Australien alleine plant derzeit 116 Öl-, Gas- und Kohleprojekte mit einem CO2-Ausstoss von 4,4 Milliarden Tonnen (Stand Ende 2023). Und wenn zusätzlich die Bedrohung wahr werden sollte, dass die steigenden Temperaturen das in den Permafrostzonen gelagerte Methan freisetzen, wird klar, so der australische Wissenschaftler Walter Jehne, dass wir vor einer unbeherrschbaren Situation stehen und das Ende der menschlichen Zivilisation – ‘Extinction’ – unausweichlich ist.
In der Tat wird die Lage nach Auftauen der Permafrostböden gänzlich unbeherrschbar und das Klima danach könnte vielen Lebewesen auf Erden die Existenz rauben, durch Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, Stürme und Verschieben von Klimakorridoren, die nur die wenigsten ertragen können. Einzeller und Pilze sind da gegenüber uns im Vorteil, sie können in ihren Generationsfolgen von wenigen Stunden oder Tagen schneller die Kandidaten auslesen, die Überlebenschancen haben. Das wird für den größten Teil der Menschheit mit einer Generationsfolge von 30 Jahren und bei der Geschwindigkeit der Klima-Veränderung so gut wie unmöglich sein.
Boden und Pflanzen als Rettung
Beschleunigt wird dieser Exodus durch den Verlust von Ackerkrume und die Desertifikation ganzer Regionen, durch falsch Bewirtschaftung. Die Widerstandsfähigkeit unserer Zivilisation, vor allem unseres Ernährungs- und Gesundheitssystems, nimmt rapide ab und damit die Sicherheitslage der Welt. “Sieben fehlende Mahlzeiten bestimmen den Unterschied zwischen sozialem Frieden und Chaos”. Diese Erkenntnis brachte 1978 den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter dazu, eine Studie in Auftrag zu geben, die das Risiko eines Klimawandels durch höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre für Amerika (und die Welt) in Bezug auf Landwirtschaft, Ernährung und die globale Sicherheit einschätzen sollte.
Schon damals wurde der CO2-Anstieg bestätigt, doch der damit verbundene Temperaturanstieg galt zu dieser Zeit noch eher als vorteilhaft für die Erträge der Landwirtschaft. Spätere Modellrechnungen waren dann pessimistischer und eine Reduzierung des CO2-Ausstosses wurde Teil der politischen Agenda. Dabei wurde die Tatsache vernachlässigt, dass CO2 für den Lebenskreislauf von Pflanzen, Tieren und Menschen unabdingbar ist und in Bezug auf den Klimawandel nur ein Symptom darstellt, das so gut wie nicht auszubremsen ist. Denn um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre konstant zu halten, müssten wir den CO2-Ausstoss um jährlich 10 Milliarden Tonnen verringern. Um ihn zu senken, um mindestens das Doppelte.
Viele hofften auf einen Ausweg durch die Ozeane. Denn sie speichern derzeit 30.000 Milliarden Tonnen CO2. Doch diese Speicherfunktion könnte sich umkehren. Denn wenn der CO2-Gehalt der Atmosphäre sinkt, könnten CO2-Speicher in den Ozeanen, die während der letzten 10.000 Jahre eingelagert wurden, wieder gelöst und an die Atmosphäre abgeben werden. Dies bis zum atmosphärischen Gleichgewicht, dem Equilibrium. Das würde alle Bemühungen und Mittel, die bisher in die Reduzierung von CO2 geflossen sind, ad absurdum führen, auch die bisher investierten 60 Milliarden US-Dollar.
Atmosphärischer Wasserkreislauf als Hebel
Die Wissenschaft weiß seit langem, dass Wasser eine bedeutende Rolle im Klimawandel spielt (90%). Das Thema wurde (damals) jedoch als zu komplex eingestuft. Walter Jehne sieht die Lösung im Boden. Er ist die absolute Voraussetzung für das Leben auf der Erde und auch die schärfste Waffe im Kampf gegen den Klimawandel. Er bestimmt den Wasserhaushalt, die Kühlung der Erdoberfläche, das Leben der Biosysteme und deren Widerstandkraft schnellen Veränderungen gegenüber.
Laut Walter Jehne liegt unsere einzige Chance, den Temperaturanstieg nicht nur zu stoppen, sondern umzukehren, in der Wiederherstellung des globalen Wasserkreislaufs, im Grün der Pflanzen. Klingt kühn? Aber er liefert das Rezept dafür und dessen wissenschaftliche Basis. Die Idee ist einfach: Wir müssen nur das machen, was die Natur seit Millionen von Jahren gemacht hat. Vor 420 Millionen Jahren gab es Ozeane und trockenes, hartes Gestein, kein Leben an Land, nur einige komplexe Zellstrukturen in den Ozeanen, basierend auf dem Nährstoffabfluss durch die Verwitterung des Gesteins. Steine sind von Natur aus wasserabweisend. Nur durch die vom Bodenleben zurückgelassenen organischen Rückstände entstehen Lufteinschlüsse, die zu einer erheblich größeren Oberfläche führen und eine Art Schwamm (‘Soil-Carbon-Sponge’) bilden, der die Speicherung von Wasser und das Eindringen von Wurzeln ermöglicht. Als nächstes begannen Pilze von den Rändern der Ozeane in die Steine einzudringen, um Nährstoffe aus den Steinen herauszulösen.
Puffer in der Klimakrise
Pilze, wie Tiere und Menschen (heterotroph), können keinen Zucker binden und keine eigene Energie erzeugen. Das können nur Pflanzen und Algen (und einige Bakterien). Pilze und Algen gingen eine symbiotische Beziehung ein, um Flechten zu erzeugen. Flechten sind immer noch maßgeblich an der Zersetzung von Material beteiligt und lassen organischen Abfall zurück, der Wasser speichern kann und so das Pflanzenleben (Flechten > Moos > Farne > Angiospermen > Gräser) an Land ermöglicht. Diese nutzen die Photosynthese, um stabilen Kohlenstoff und Zucker im Boden zu schaffen. Bodenbildung ist die Kombination von mineralischen Partikeln und organischem ‘Abfall’. Innerhalb von 100 Millionen Jahren hat sich das Leben über 13 Milliarden Hektar eisfreien Landes ausgebreitet.
Das Resultat war eine reichhaltige Pflanzenwelt, die eine Kohlenstoffreduzierung in der Atmosphäre von 7000 ppm (vor Pflanzenleben) auf 100 ppm ermöglichte. In Steppen und Savannen entstehen Pflanzenfresser (insbesondere Wiederkäuer), die ein symbiotisches Verhältnis zu den Gräsern besitzen. Sie halten den Nährstoff-Wasser- und Methan-Haushalt auf dem Globus in der Balance.
Aus der Erdgeschichte lernen
Für Walter Jehne geht es heute darum, diesen Prozess erneut zu kopieren. Die Vegetation als wirksamstes Mittel im Kampf gegen die wachsende CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre zu nutzen, was sie schwächt. Dabei spielt die Art der Landbewirtschaftung eine zentrale Rolle. Abholzen, roden und abtöten von Vegetation, Brandrodung verstärken für Jehne die CO2-Belastung genauso wie Biozide und synthetische Dünger, intensive Bewässerung und Brache. Was entlastet, ist stete Begrünung aller kultivierbaren Landstriche der Erde. Nur eine solche Politik, in der die grünen Pflanzen den CO2-Haushalt und durch sie den Wasserhaushalt der Erde wieder ins Gleichgewicht bringen, kann Entlastung an der Klimafront bewirken. Und nur so könnte die wachsende Erdbevölkerung und die kommenden 10 Milliarden Menschen in Zukunft ernährt und die Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe gesichert werden.
Übersetzung und Zusammenfassung
Die Übersetzung und Zusammenfassung des Texte leistete Wilhelm Wallefeld. Sie beruht auf den Vorträgen „Clear Directions on regenerative Practice“ sowie „Conversations from the Edge“ von Walter Jehne.
Wilhelm Wallefeld und seine Frau Brigitte wirtschaften seit mehr als 40 Jahre als Farmer in Westaustralien. Derzeit auf ihrer Farm in Denmark/ Westaustralien, die sie nach ökologischen Prinzipien ausgerichtet haben. Wilhelm Wallefeld ist seit 5 Jahren Vorstandsmitglied des IWE. Er verfolgt die Entwicklung der Regenerativen Landwirtschaft als Zukunftsmodell der ökologischen Landbewirtschaftung weltweit.
Hier noch einige zugrunde gelegte physikalische Gesetzmäßigkeiten und Zahlen:
- Die ‘Keeling Kurve’ der CO2-Entwicklung: Nach Keeling werden pro Jahr 10 Milliarden t CO2 mehr emittiert als absorbiert. Der Anteil der Öl- und Gasindustrie beträgt 8 Milliarden t oder 4%. Der überwiegende Anteil beruht auf ‘natürlichen’ Prozessen.
- Unter Anderem schlägt das Verbrennen von 350 Mio ha Wäldern mit zwischen 10 und 100 t/ha und 2 Milliarden ha Grasland mit 2 bis 5 t/ha CO2-Ausstoß erheblich zu Buche.
- Die Schwankungen innerhalb des Jahres beruhen auf der Photosynthese/Re-Oxydation im Vegetationszyclus (grün oder braun).
- Nach dem ‘Stefan Boltzmann Gesetz’ über Hitzeabstrahlung strahlt ein unbedeckter Boden ein Vielfaches des begrünten Bodens an Wärme zurück in die Atmosphäre.
- Mit lebenden Pflanzen bedeckter Boden wird selten wärmer als 20C, während unbedeckter Boden (z.B. im Australischen Sommer) bis zu 70C heiß werden kann.
- Die Sonneneinstrahlung und die Reflexion sind wegen der Klimagase in der Atmosphäre aus der Balance: Die Einstrahlung ist 342 W/sqm und die Rückstrahlung ist wegen der Klimagase nur 339 W/sqm. Die Differenz von 3 W/sqm trägt zum Temperaturanstieg bei.
- Andererseits gilt: 1 ha Wald transpiriert 40.000 l Wasser, dessen Umwandlung in Wasserdampf bedarf 590 cal/l und trägt so erheblich zum Kühlprozess unseres Planeten bei.
- Eine hohe Wärmeabstrahlung über Trockenregionen verursacht einen Hitzekegel, der verhindert, dass feuchte Luft (und damit Niederschläge) vom Meer ins Inland gelangt.