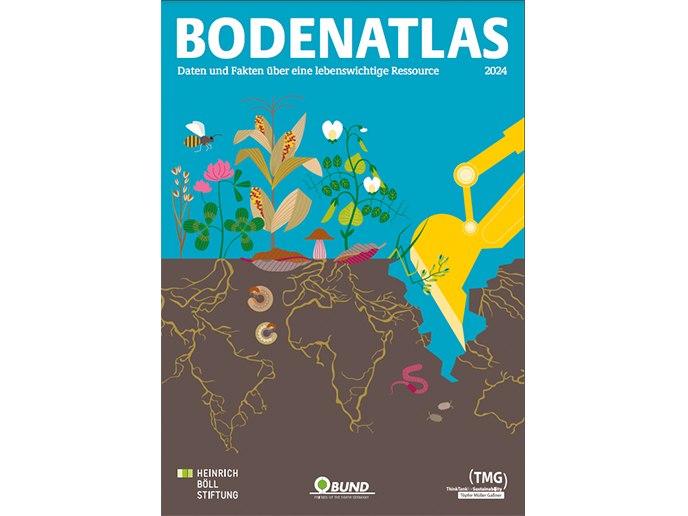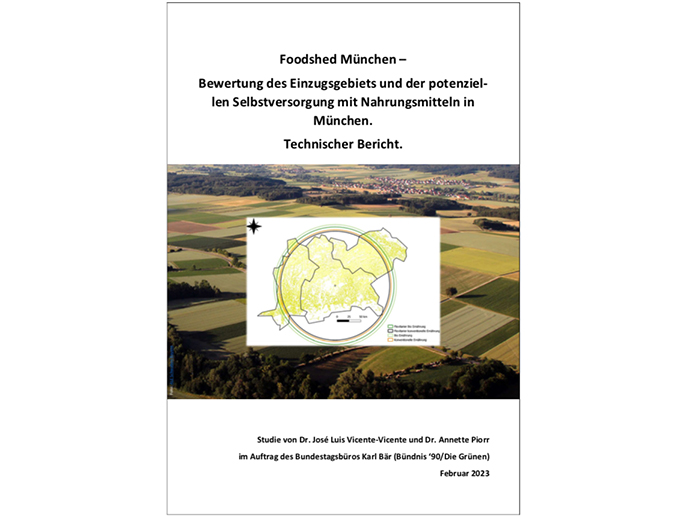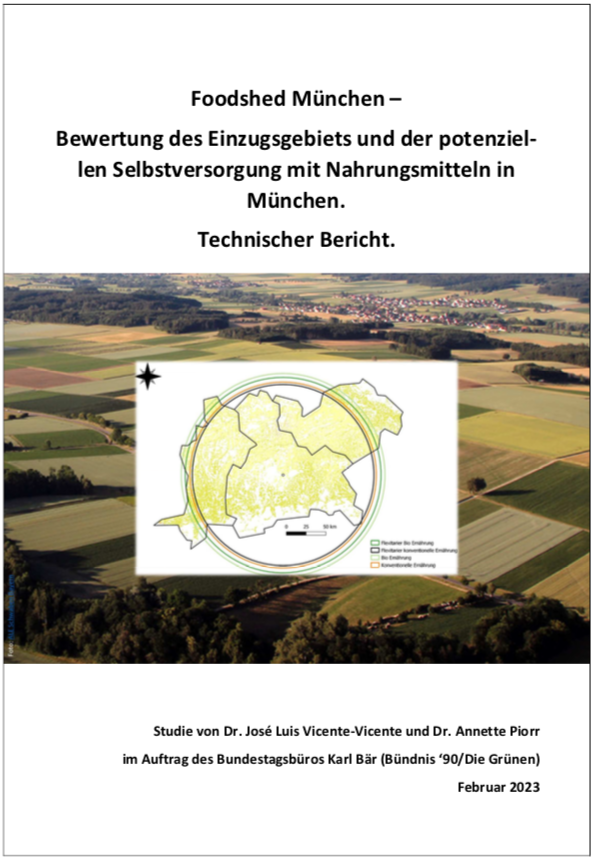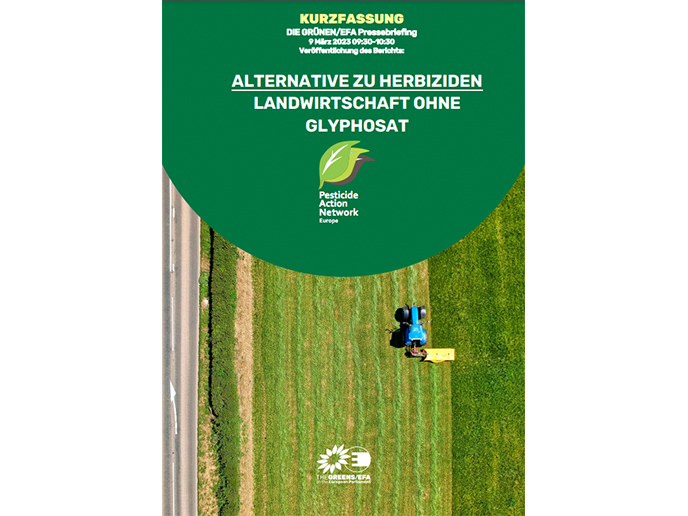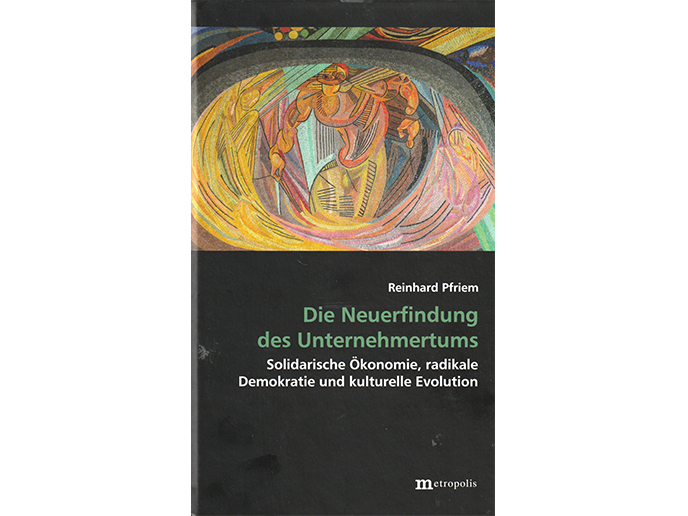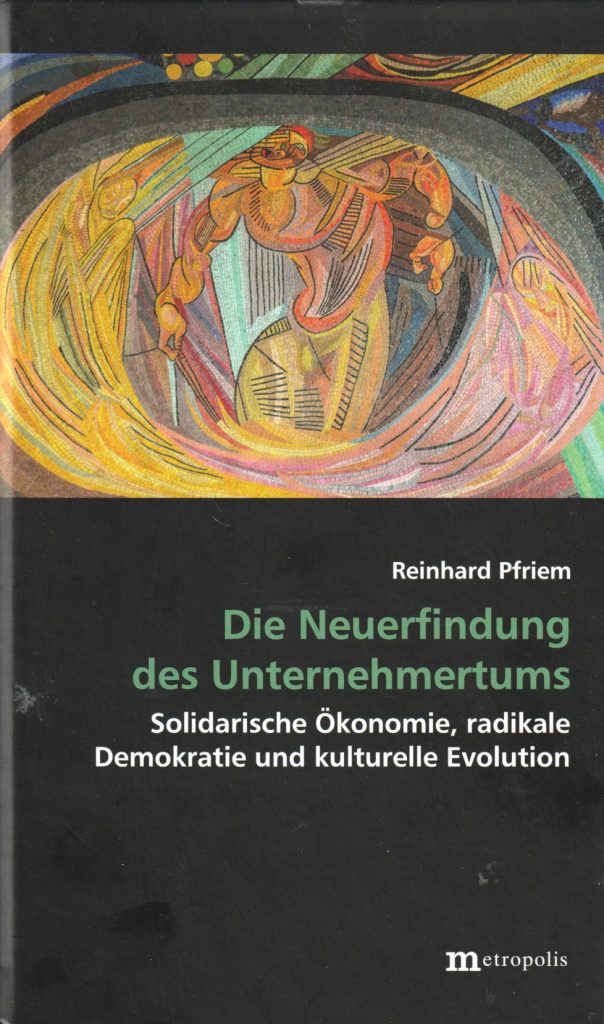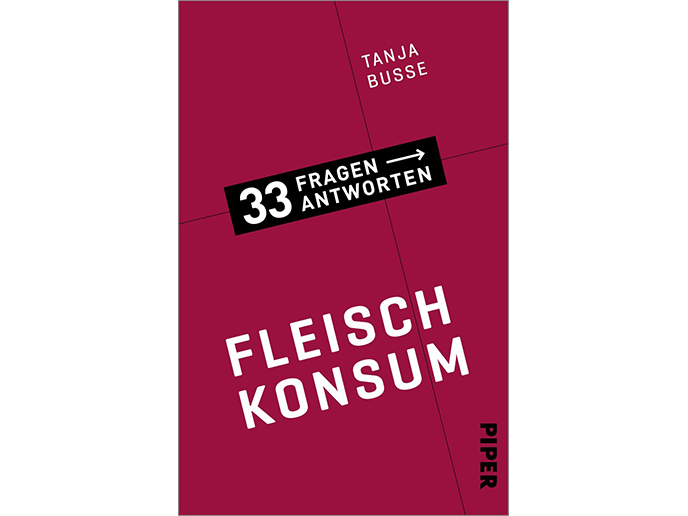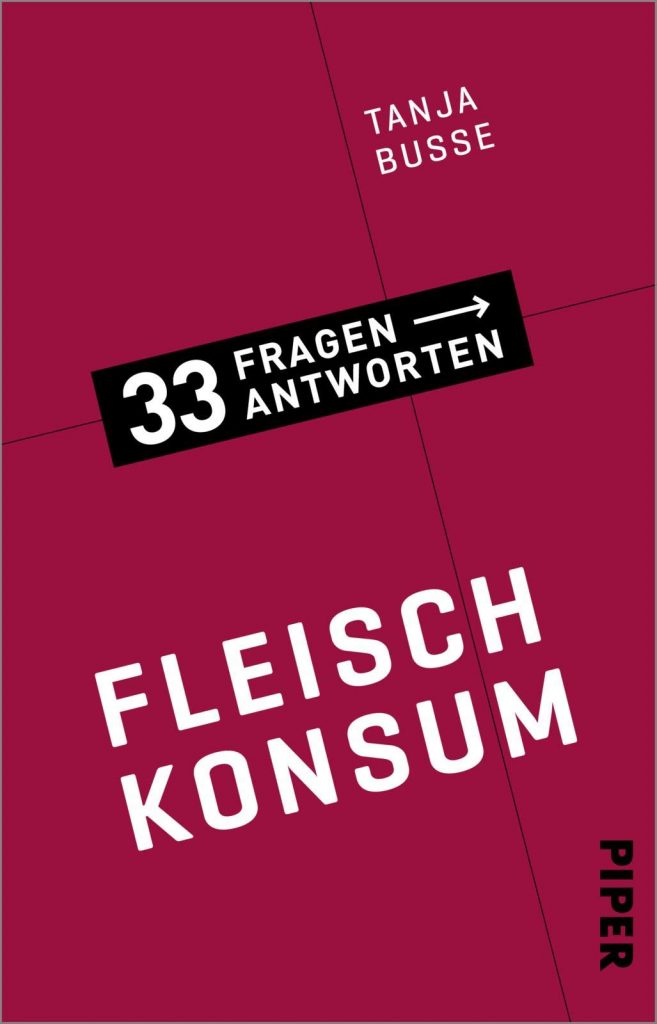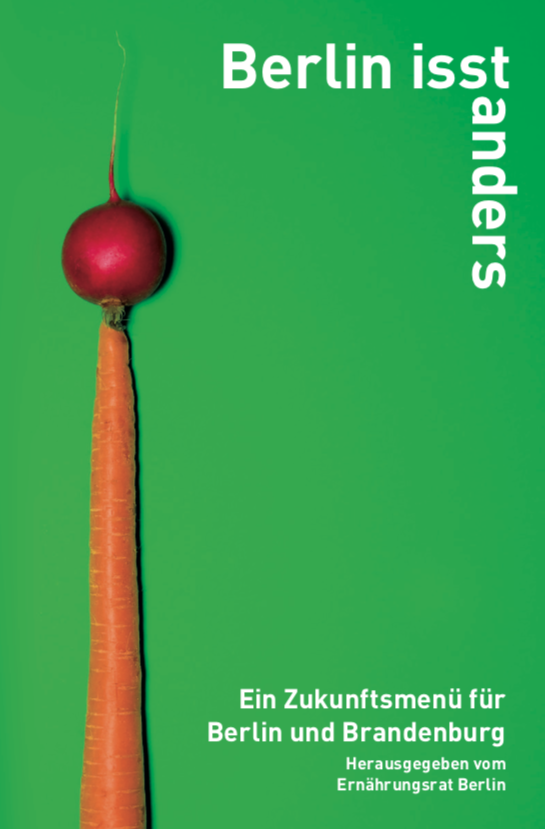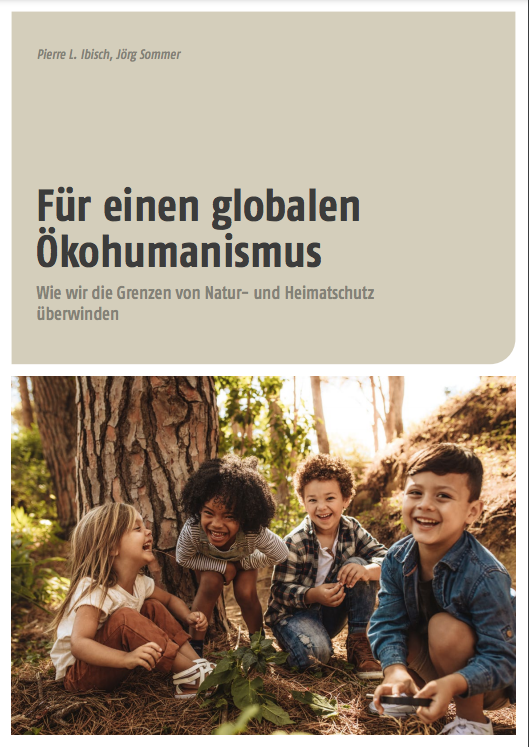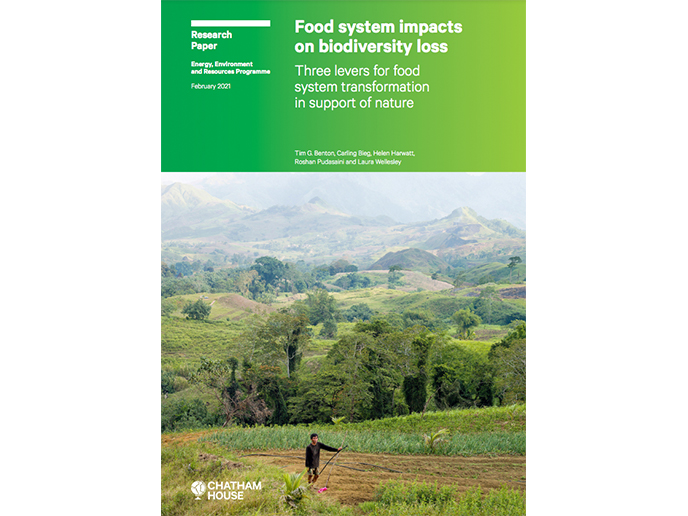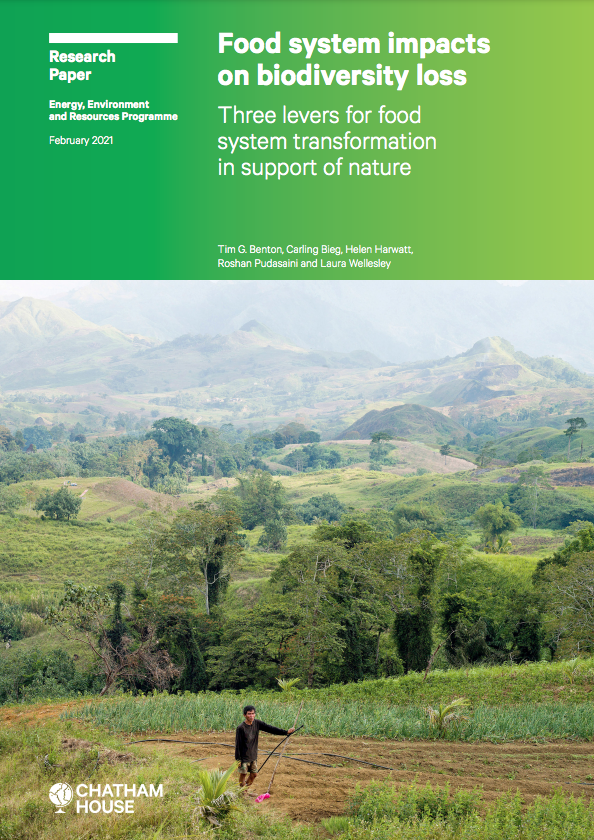Pressemitteilung PIK, 29.1.2024
Eine umfassende Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme auf der ganzen Welt würde zu sozioökonomischen Gewinnen in Höhe von 5 bis 10 Billionen US-Dollar pro Jahr führen – das zeigt ein neuer globaler Bericht, der von führenden Forschenden der Ökonomie und aus der Food System Economics Commission (FSEC) erstellt wurde. Die bisher umfassendste Studie zur Ökonomie von Agrar- und Ernährungssystemen macht deutlich, dass diese derzeit mehr Wertschöpfung zerstören als sie hervorbringen und dass eine Überarbeitung der politischen Rahmenbedingungen für Ernährungssysteme dringend erforderlich ist. Darüber hinaus wären die Kosten einer Transformation viel geringer als der potenzielle Nutzen, der vielen Hundert Millionen Menschen ein besseres Leben ermöglichen würde.
„Die Kosten, die dadurch entstehen, dass wir das schlecht funktionierende Ernährungssystem nicht aktiv umgestalten, werden die Schätzungen dieses Berichts vermutlich noch übersteigen, da sich die Welt weiterhin auf einem extrem gefährlichen Kurs befindet. Wir werden wahrscheinlich nicht nur die 1,5°C-Grenze überschreiten, sondern auch mit einer jahrzehntelangen Überschreitung konfrontiert sein“, erklärt Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und FSEC-Initiator. „Der einzige Weg, um dann wieder auf 1,5°C zu kommen, ist der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, die Bewahrung der Natur und die Umwandlung der Agrar- und Ernährungssysteme von einer Quelle für Treibhausgase hin zu einer Senke. Damit hängt die Zukunft der Menschheit auf der Erde von diesem globalen Ernährungssystem ab“, fügt er hinzu.
Ernährungssysteme als wirksames Mittel, um 174 Millionen Menschen vor vorzeitigem Tod zu bewahren
Der Bericht liefert die bisher umfassendste Modellierung der Auswirkungen von zwei möglichen Zukunftsszenarien für das globale Ernährungssystem: unseren derzeitigen Pfad der aktuellen Trends und den Pfad der Transformation des Ernährungssystems. Für den Pfad „Aktuelle Trends“ skizziert der Bericht, was bis 2050 passieren würde, selbst wenn die politischen Entscheidungsträger alle derzeitigen Verpflichtungen einhalten: Die Ernährungsunsicherheit wird in einigen Teilen der Welt immer noch dazu führen, dass 640 Millionen Menschen (darunter 121 Millionen Kinder) unterernährt sind, während die Fettleibigkeit weltweit um 70% zunehmen wird. Die Ernährungssysteme werden weiterhin für ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sein und so auch bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer Erwärmung von 2,7 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten beitragen. Zudem wird die Nahrungsmittelproduktion zunehmend anfällig für den Klimawandel, da auch die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen drastisch zunehmen wird.
Der FSEC-Bericht stellt zugleich fest, dass das Ernährungssystem stattdessen einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten und Lösungen für Gesundheits- und Klimaprobleme vorantreiben könnte. Auf dem Pfad zur Transformation des Ernährungssystems zeigen die Ökonominnen und Ökonomen, dass bis 2050 bessere Strategien und Maßnahmen dazu führen könnten, Unterernährung zu überwinden und insgesamt 174 Millionen Menschen vor einem vorzeitigen Tod durch ernährungsbedingte chronische Krankheiten zu bewahren. Die Ernährungssysteme könnten bis 2040 zu Netto-Kohlenstoffsenken werden und so dazu beitragen, die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter 1,5 Grad zu begrenzen, zusätzliche 1,4 Milliarden Hektar Land zu schützen, die Stickstoffüberschüsse aus der Landwirtschaft fast zu halbieren und den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Darüber hinaus könnten 400 Millionen Beschäftigte in der Landwirtschaft auf der ganzen Welt ein ausreichendes Einkommen erzielen.
„Die Kosten für diese Transformation – schätzungsweise 0,2 bis 0,4 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung pro Jahr – sind gering im Vergleich zu den Vorteilen, die sich daraus ergeben würden und die wirtschaftlich mehrere Billionen Dollar pro Jahr ausmachen. Ernährungssysteme haben ein einzigartiges Potenzial, um globale Klima-, Umwelt- und Gesundheitsprobleme gleichzeitig anzugehen – und damit Hunderten von Millionen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen“, sagt Hermann Lotze-Campen, FSEC-Kommissionsmitglied und Leiter der Forschungsabteilung „Klimaresilienz“ am PIK.
„Anstatt unsere Zukunft mit einer Hypothek zu belasten und steigende Kosten anzuhäufen, die zu hohen versteckten Gesundheits- und Umweltkosten führen, sollten sich die politischen Entscheidungsträger der Herausforderung der Agrar- und Ernährungswende stellen. Jetzt müssen Veränderungen vorgenommen werden, die kurz- und langfristig weltweit enorme Vorteile bringen werden“, sagt Ottmar Edenhofer, PIK-Direktor und FSEC-Ko-Vorsitzender. „Dieser Bericht sollte die dringend benötigte Diskussion zwischen den wichtigsten Interessengruppen darüber anstoßen, wie wir diese Vorteile nutzen können, ohne jemanden zurückzulassen“, erklärt er abschließend.
Die Food System Economics Commission (FSEC) ist eine unabhängige akademische Kommission, die politische und wirtschaftliche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger mit Instrumenten und Fakten ausstatten soll, um die Ernährungs- und Landnutzungssysteme zu verändern. Sie bringt führende Expertinnen und Experten aus den Bereichen Klimawandel, Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und natürliche Ressourcen zusammen und umfasst Organisationen wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Weltgesundheitsorganisation, die Weltbank, die London School of Economics, das World Resources Institute Africa und viele andere. Der FSEC Global Policy Report baut auf jahrelangen Studien auf, einschließlich des EAT-Lancet-Berichts. Der Report betrachtet den Wandel der Ernährungsysteme nicht nur unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern auch der globalen Gesundheit, Ernährung, wirtschaftlichen Entwicklung und sozialen Eingliederung.
Hier geht es zum FSEC Global Policy Report „The Economics of the Food System Transformation“.